Krunoslav Pranjić, Zagreb
Juridičko-literarni diskurs u Pravorijeku Vladimira Primorca
|
Prof. dr. Krunoslav Pranjić
Di 7. 5. 2002 |
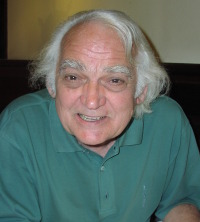
|
Vladimir Primoracs Urteil
Als sofistizierter Diskurs und Memento
Kruno Pranjić
Vor diesem Buch der wahren Prachtkolumnen, vor der Aufgabe, von ihnen nur einige typologisch repräsentative nach ihrer Textur und ihrem Inhalt sowie ihrer Ausdruckskraft auszuwählen – verzweifeln die „Selektoren“ nicht dabei, welche sie nicht wählen sollen, sondern welche sie wählen sollen, denn die Kolumnen – jede einzelne sind gerade modelhaft, jede vereint in sich die informative Konsistenz und – als wäre sie von einem Romanschriftsteller – das ringförmige Sujet.
Der zweite erschwerende Umstand dieses selektiven Einengens ist, dass die unterzeichneten „Selektoren“ dieses fünfteiligen Collageblocks auch über Vladimir Primorac und über sein Urtel schwer irgendwas mehr (auf)zeigen könnten, als dass schon Kurzgefasstes kürzer zu fassen oder dies nur mit überflüssigen Kommentaren aufzulockern. Im I. Teil gibt es nämlich drei integrale (VP.) Kolumnen, die für „die Thematik, die Textur und den Diskurs vom Urteil typologisch repräsentativ“ sind; die erste ist (Das hintergangene Staatsoberhaupt) in einer tosenden Kombination von Humoristischem und Groteskem sogar, mit dezent Majestätischem, Affirmativem; nämlich schon in der Überschrift ist die literarisierte Geringschätzung anwesend: hintergehen [kroat. popušen ] ist ein Jargonausdruck für jemanden, der „reingefallen ist“, „einen Schaden erlitten hat“, d.h. schlecht, „übel und verkehrt“ bei etwas davonkommen, wie der amerikanische Präsident Clinton in der trivialen (immerhin: wenn auch ein wenig menschlichen) „Affäre“ mit „Demoiselle“/„Fräulein“ Monica Lewinsky; gleichzeitig war die reaffirmierte amerikanische Justiz imstande, auch den Präsidenten zu einem öffentlichen „informativen“ Gespräch vorzuladen?! (Siehe die beiliegende Kolumne 1!). Sogar auch seine Präsidentschaft in Frage zu stellen. Die zweite Kolumne ist Hakenkreuz und Stern vom 24.6.2000 nun ziemlich nach dem Wahlsieg der Oppositionskoalition über die HDZ (3.1.2000). Die Kolumne bezeugt, dass
Vladimir Primorac auch der neuen Regierung nicht nachgibt, sondern dass er auch sie mit seinem kritischen Skalpel seziert; noch stärker vertreten ist das kritische Verhältnis in der dritten Kolumne (Übermacht), als er sich anlässlich einer Nachricht in der Zeitung meldet, wie die neue Obrigkeit eine „neue Spezialeinheit der Polizei“ plant (eigentlich mehr als „in den Himmel schreiend“ erforderlich) für den Kampf gegen allerlei organisierte Kriminalität. Doch der vereidigte Jurist, Richter aus Berufung, Legitimist, Liberale und Demokrat bis ins Mark, „ein Mann aus einem ganzen Stück und von Format“, spricht sehr laut bei dieser Gelegenheit: Der Staat verteidigt sich nicht gegen Kriminalität an seinen offiziellen Institutionen vorbei. Und so, genauso wie er kritisch unnachgiebig war gegenüber der ehemaligen „Demokratur“, bleibt er kritisch gerecht auch gegenüber der siegreichen Koalitions“demokratur“ (und in ihr sind in zahlreichen Ressorts seine ehemaligen Parteigenossen aus der HSLS). Ein Mann mit Rückgrat!
Im II. Teil befinden sich die kommemorativen Erinnerungen an Vladimr Primorac aus der Feder von drei herausragenden kroatischen Intelektuellen; im III. Teil ist kurz zusammengefasst, was der Autor über sich selbst gesagt hat in Interwievs mit einem Gentleman (D. H.) und mit einer Lady (H. E.). Im IV Teil sind „Universalien & Aktualitäten“ aus dem Urteil, die nach der Meinung der „Selektoren“ auch außerhalb des Kontextes selbständig als sprichwörtliche Aussagen (diagnostische Sentenzen/Maximen) funktionieren können, vom bleibenden Wert für die zeitgenössische kroatische Gesellschaft. Im V Teil sind nun drei autorisierte Texte, die die Redner dem Publikum bei öffentlichen Veranstaltungen in Zagreb („Literaturabend am Freitag“ in der Stadtbibliothek und an der Philosophischen Fakultät – K. P. und A. U., und M. G. an der Juristischen Fakultät der Universität) angeboten haben.
- Aus der Perspektive meines „Faches“ (des sprachwissenschaftlichen und stilistischen) kehre ich jetzt zu einer fraktalen Präsentation und Interpretation des Stils und der Sprache des Autors, komplexer (und „moderner“) ausgedrückt: seines Diskurses, in der Hoffnung, dass das Fraktal per definitionem als ein Teil ausgemacht ist – fähig, das verkleinerte Abbild seiner Gesamtheit zu reflektieren. Dies zeige ich an Beispielen, mich auf das 1. Zitat in „Universalien & Aktualitäten“ (Teil IV) berufend, dem auch dieses (kürzere) komplementär ist:
Kroatien hat sich bis jetzt zu sehr kompromitiert wegen der, milde gesagt, wohlgesinnten Einstellung zum Ustaschatum. Die Botschaften, die wir in die Welt auf der Ebene der Symbole senden, sind wahrlich so, dass man Kroatien als ein Land ansehen kann, dem der Nazifaschismus in Ustascha-Form nicht fremd ist... (Urteil, 14)
Zusammen mit diesero aufrufenden 1. Zitat aus dem Teil „Universalien & Aktualitäten“ (Urteil, S. 8/9) ist dies eine richtige juridische Philippika, Concerto grosso im furioso Tempo, als Zeugnis (a Û tutta forza/fortissimo) über Vladimir Primorac, den „Komponisten“, einen einzigen (ehrbaren) Makel teilt er mit K. R. Popper: Nichtolerierung der Intoleranz; eine idiosynkratische Abneigung auch gegen einen ganzen Aufruf zu Gewalt und Grausamkeit, zu irgendwelcher Vertilgung, „Säuberungsaktion“, worunter unser Autor das Propagieren des Serbenfressens (Serbofagie) und Antisemitismus versteht.
- Im Gegensatz zu dem schon erwähnten Tempo für das Concerto grosso, jetzt als Opposition zum Tempo moderato, mit einem Decrescendo im Ton folgt eine echte lyrische Miniatur von Wortzusammensetzungen, die unser Autor – sagen wir – nur für Janigros1 Zagreber Solisten „komponierte“:
Die Liebe zur Heimat fasse ich so auf, dass ich Kroatien das Beste gebe, was ich kann. Und dass Kroatien so organisiert wird, dass fachkompetente und ehrenhafte Menschen an ihren Plätzen sitzen und dass sie dann Kroatien zu einem modernen demokratischen Land machen. Dass sich in Kroatien keiner als Minderheit fühlt. Dass Kroatien ein Staat und eine Gesellschaft gleichberechtigter Menschen wird. Dass die Menschen in Kroatien glücklich sind, weil sie in ihm leben, nicht nur wegen des finanziellen Reichtums, sondern auch wegen ihrer Sicherheit, weil sie geschätzt werden, wegen der Menschenrechte, die es hat. Vlado Gotovac hat einmal gesagt, dass er vor Scham sterben würde, wenn er erführe, dass sich jemand vor ihm fürchte. So müsste jeder nachdenken.2
So ein Patriotismus ist sicher nichts „Abzeichenhaftes“, dass man im Knopfloch seines Jackenumschlags anbringt; er wird in der Handmuschel aufbewahrt und kann weder in der Bank (mit Devisen, Silberlingen oder mit Kuna – egal!), noch durch einen BMW, noch durch eine Hazienda, oder irgendein Benefitium oder durch irgendein anderes Privileg vermarktet werden. So wie jede wahre Liebe enthält Primoracs Liebe zur Heimat den Zweck in sich selbst, man erweist sie ohne Erwartung einer Vergütung oder Besserung der gesamten Volksgemeinschaft...
- Ein Pragmatiker oder ein intellektueller nihilistischer Zyniker würde sagen; ein edler Ritter von Mancha, idealistisch, allzu idealistisch ist dieser dein/unser Vladimir; so rufen wir SSK (Silvije Strahimir Kranjčević)3 zur Hilfe, der das Gedicht Moses mit dem Distichon beendet:
Du stirbst, wenn du selbst anfängst
An deine Idealen zu zweifeln!
Aber es wird wohl so sein: Die Ideale sollen unerreichbar sein, denn: schaut nur auf programmatisch deklarierte „zweihundert Familien“ mit Ihren kriminell erworbenen Bankdividenden, fahrenden Gestüten, Yachten, Mächten und Befugnissen, „mit Hahnenschwänzen“ (= Cocktails) sowie anderen Benefizien, während das Volk, die Bevölkerung...
Stärker als Kranjčevićs „Sterben“ wegen des Zweifelns an seinen Idealen strahlt ihre Realisierung, besonders wenn das vergegenständlichte/reifizierte Ideale sind (auf eine schon angeführte Art).
Außerdem: Auch unsere Generationen haben die Verwirklichung des Ideals einer freien und unabhängigen Heimat erlebt. Na und?
Wie Goethe, der Eckermann hatte, und Krleža, der seinen / unseren4 hatte, als ihn dieser fragte, was er 1968 über die Studentenrevolte in Europa und den USA denkt, hat ihm Miroslav Krleža geantwortet:
- Sie werden schon sehen, auch sie werden die Verwirklichung ihrer Ideale erleben!?
Auch wenn er streng war und hohe Anforderungen stellte, was die richterliche fachliche Ausbildung und ethische Standfestigkeit angeht, ist unser Autor auch hier kein dogmatischer Ultra, sondern hat viel Verständnis für die zerbrechlichen Seiten der menschlichen Natur in ungünstigen Statusbedingungen.
Wie ein „Humanist des Prähumanitären“ konzedierte er (im Interview mit D.H., zitiert im III. Teil):
Unbedeutend ist die Angst vor Krankheiten oder anderen zahlreichen Phobien, die ein Teil des Krankheitsbildes eines Psychoneurotikers sind. Wegen dieser Ängste geht man zum Arzt, um Hilfe zu suchen. Hier aber handelt es sich um die Angst um die eigene Existenz und die Existenz seiner Familie, die das Leben aufs Überleben zurückführt, aber viele sind in der Lage, für dieses Überleben alles zu tun (solche kenne ich) oder passen sich wenigstens an (auch solche kenne ich).
- Hier sind die bekannten Verse des bekannten zehnsilbenschreibenden epischen Dichters5 angebracht, die mit Primorac auf der gleichen Wellenlänge sind, was das Verständnis für die menschlichen Schwachen angeht:
-
Angst besudelt oft die Ehr im Leben,
Schwachheit kettet uns an diese Erde.6 - Und dass sich ein moralischer und mutiger Richter in der Anwendung der Gesetze nicht voluntaristisch und arbiträr benehmen darf und dass er bei der Interpretation und Anwendung derselben keine außerrechtlichen Gründe einbringen darf, kein höheres Ziel – macht Vladimir Primorac zu einem Seelenverwandten von Hermann Hesse, dem herausragenden deutschen Anti-Nazi (ab 1923 Schweizer Staatsbürger, Literaturnobelpreisträger von 1946), wenn er im Glasperlenspiel, einem Roman mit dem Ideal einer Einheit zwischen Wissenschaft, Geistigkeit und Kunst, vermerkt wie „die Wahrheitsliebe, die intellektuelle Ehrbarkeit, die Treue zu den Prinzipien des Geistes zum Vorteil von irgendetwas, wenn auch nur der alleinigen Heimat, zu opfern – Verrat bedeutet. “
Zwei „Aussagen“ von Primorac im Urteil sind wieder auf der Wellenlänge,
diesmal von Hesse:
Das Fach kennt keine Reue: Wer das Fach verrät, hat den Zweck seines
Bestehens verraten. (169)
Die Staatsforderung ist kein Umstand, der die Gesetzeswidrigkeit
irgendeines Deliktes ausschließt. (170)
Es ist keine Indiskretion: Freunde wissen, dass „Vlado“ sehr oft verzweifelt war gerade wegen des allgemeinen moralischen Marasmus, wegen Korruption, wegen Plünderung von Volkseigentum, wegen Steuerhinterziehung – alles gerichtlich nicht prozessuiert wegen ... wegen ... Mit dem geschriebenen Wort (im „Feral“) hat er heftig die physischen und mentalen Malformationen in der Gesellschaft und zu dem gegenwärtigen vaterländischen Zeitpunkt gebrandmarkt. Er fragte sich Öffentlich: – Was bedeutet überhaupt eine allgemeine Rede über die „Moralität in der Politik“ oder „Politik, die eine Hure ist", aber dies nicht sein dürfte? Ich spreche natürlich – sagt Primorac – metaphorisch wie der, der (nichtssagende) Reden hält, und dabei nicht sagt, wer die wahre Hure in dieser Gesellschaft ist.7 Metaphorisch wird auch der Unterzeichnete das gerade Zitierte kommentieren: in allen Urteilen von Vladimir Primorac, die aristidisch gerecht sind, a Û la Zola einst, ruft er leidenschaftlich ( J’accuise ) nicht nur die Huren in dieser (unserer kroatischen) Gesellschaft, sondern auch die Hurensöhne (und -tochter) auf – wie dies gewöhnlich unsere Landsleute schon in Dalmatien und auf den Inseln sagen – ohne Rücksicht und ohne Blatt vor dem Mund nennt er die Dinge beim richtigen Namen.
Und wieder: Freunde wissen, wie oft er verzweifelt zwei von Ciceros bekannten Ausrufen wiederholte, einen verteidigenden (Pro Rabbirio): Ubi terrarum summus (= in was für einem Land befinden wir uns), einen anklagenden (In Catilina): Ubina gentium summus (unter was für Leute sind wir geraten?!).
Aber trotzdem, obgleich – obwohl – dennoch – zum Trotz – im Gegenteil und trotz allem hat er nie das Prinzip Hoffnung8 verloren, was er bestätigte, indem er auf bessere Zeiten hoffte (Utopie?), als er im selben Interview mit H. E. offenbarte:
Wirkliche Veränderungen im politischen Leben Kroatiens können nur neue, junge Menschen bringen für die die Politik ein Handwerk sein wird, die Bekanntes in Reden meiden werden, da die Zeit sol cher Reden längst vorbei ist. Es ist die Zeit für Menschen, die sich mit den existenziellen Problemen der Gesellschaft und nicht mit leeren Reden beschäftigen werden.
Für Vladimir Primorac könnte man kaum eine passendere Qualifikation/Charakteristik finden, als dass man ihm die Attribution zuweist, dass er ein sehr urbaner Mensch, Schriftsteller, und Jurist/Richter, und Denker – und: Freund ist; denn die Urbanität lag in seiner Natur und in seinem Verhalten. Über den Ausdruck und den Inhalt des adjektivisch-substantivischen Paares urban/Urbanität – ein kleiner „sprachliebender“ (= philologischer) Exkurs: urbamus/ urbanitas (<lat. urbs = Stadt), eine grapho-fono-morpho-Adaptation des englischen urbane/urbanity, des deutschen urban/Urbanität, des französischen urbain/urbanite Û), in den slawischen Sprachen (inklusive Kroatisch) wird am häufigsten der terminus technicis im Städtebau und in der Stadtplanung verwendet, während er in den germanischen und romanischen Sprachen eine ganze Menge nahestehender und verschiedenartiger Nuancen belegt; es wird nur eine adjektivische übersetzende Form (leicht umwandelbar in abstrakte Substantive) aus allen vier bezeichneten Sprachen aufgeführt: höflich, zuvorkommend, manierlich, gebildet, feinfühlig, mit gutem Geschmack, bescheiden, Hebenswürdig, wohlwollend, vornehm, anständig, wohlerzogen, herrlich, zartfühlend, taktvoll, mild, lieblich, geistreich, geschickt, scharfsinnig, schönsagend, eines anderen/nahestehenden (Ver)Ehrer ... Genug? Es wird nicht übertrieben sein, all die Fülle dieser tugendhaften Charakteristika der Person Vladimir Primorac zuzuschreiben, weil das für ihn inhärente /kohärente Werte sind, vom hellenischen Kulturerbe (Platon u.a) bis in unsere Zeit (bis K.R.Popper) universale geistige Werte als komplementare Kulturen sind: intellektuelle, ästhetische, ethische und politische. Das sind zeitüberdauernde Werte, denn sie sind für alle Zeiten, statisch, d.h. unveränderbar, unutilitär, d.h. unausnutzbar und (sind) ein Mittel gegen: Hochmütigkeit, Barschheit, Vulgarität, Habgier, Gefühlslosigkeit, Hass sogar auf den Anderen /Nächsten, und: Gleichgültigkeit – eine Sünde (sagen die einen), die ansteckender und gefährlicher ist als der Hass selbst...
Hier muss eine angebrachte Kritik hinzugefügt werden (verwandt mit Primoracs Räsonieren): Platon war ein Theoretiker der absolutistisch-aristokratischen Regierungsform. Als Grundproblem der Staatslehre hat er die folgende Frage gestellt: „Wer soll regieren?" Wer soll den Staat führen? Viele, die Leute, die Massen, oder einige Wenige, Ausgewählte, die Elite? Wenn die Frage „Wer regieren soll? “ als Grundlegendes betrachtet wird, dann bleibt offensichtlich nur eine vernünftige Antwort: keine Unwissenden, sondern Wissende, Weisen; nicht der Pöbel, sondern einige wenige Hervorragende. Das ist Platons Theorie des Regierens der Besten – die Aristokratie ... (und) es ist klar, dass die grundlegende Frage der Staatslehre völlig anders lautet, als sie Platon gestellt hat. Sie lautet weder „Wer soll regieren?" noch „Wer soll die Macht ausüben? “, sondern „Wie viel Macht soll man der Regierung geben?" oder vielleicht genauer „Wie sollen wir solche politischen Einrichtungen aufbauen, dass die unfähigen und unmoralischen Herrscher keinen großen Schaden anrichten können? “ . Mit anderen Worten, das fundamentale Problem der Staatslehre ist das Problem, die politische Macht zu zügeln – Willkür des Machtmissbrauchs – mit Einrichtungen, die diese Macht verteilen und überwachen ... Für uns bestehen nur zwei Regierunsformen: die, die den Menschen, die der Macht unterstellt sind, ermöglicht, dass sie sich ihrer Machtbesitzer ohne Blutvergießen entledigen und die Form, die ihnen das nicht ermöglicht oder in der das nur mit Blutvergießen möglich ist. Die erste dieser beiden Regierungsformen wird nomalerweise Demokratie genannt, und die andere Tyrannei oder Diktatur. Aber die Bezeichnung ist nicht wichtig, sondern der Inhalt (Karl R. Popper, U potrazi za boljim svijetom, Zagreb: Kruzak 1977. S. 233)9.
Aber da auch die Einrichtungen menschliche Angelegenheit sind, können sie auch – wie sehr sie auch von der lokalen Selbstverwaltung bis zum Parlament prinzipiell fest positioniert sind – im Dienste des gesellschaftlichen Interesses enttäuschen und versagen; in der Demokratie hilft uns dann ein informelles Institut der bürgerlichen Selbstorganisierung (und Ungehorsam – dachte und sagte in vielen Gelegenheiten V. Primorac).
In der Textur der Kolumnen von Vladimir Primorac sind seine Stilisierungen nicht fachlich monoistisch, sondern raffiniert pluralistische Elokutionen: sowohl soziologische als auch politologische, philosophische und überall auch noch literarisiert, obwohl sie meistens ein juridisches Thema haben, – alles erlaubt durch Konventionen und Charakteristika des Genres Essay, Feuilleton und Polemik. Seine Exkurse z. B. in die Zitiertheit, teils illustratorisch – teils illuminationistisch, sind kontextuell nicht unmotiviert, auch dann nicht, wenn sie sich an Shakespeare oder Moliere wenden, auch nicht wenn sie Kafka, Hemingway oder Camus ergreifen...
- Es ist wahr, er hat den einheimischen (unseren einzigen) Literaturnobelpreisträger (1961), Ivo Andrić, nie in seinen Texten direkt oder unmittelbar erwähnt, aber er hat deshalb – ob es Intuition ist, ob es spontan ist: egal – eines seiner repräsentativen Literaturverfahren nachgeahmt. Nikola Milošević10, ein ausgezeichneter Andrić-Kenner, hat dieses Verfahren Beschränkung/Limitierung) genannt. Miloševićs Exemplifikation ist aus dem XVI. Kapitel von Andrićs Chronik aus Višegrad „Die Brücke über die Drina“:
-
Die Brücke stand auch weiterhin, wie sie schon seit jeher war, mit ihren ewig jungen vollendeten Gedanken und guten menschlichen Taten, die nicht wissen, was Altern und Veränderung sind, und es scheint wenigstens so [hervorgehoben von N.M.], dass sie nicht das Schicksal der vergänglichen Dinge dieser Welt teilen. (O.c., S.225)
- Dass nicht einmal die gegenständliche Wirklichkeit: die Brücke (oder im Original ćuprija <tur. köprü, aber schau: <griech. ge Ûphyra), als semiotisches Symbol und Allegorese der Verbindung (als Gegenmittel zur Trennung) Andrić so sehr ans Herz gewachsen, verschont blieb von der besagten Neigung zur „Beschränkung", wenn da nicht Andrićs Adverb der Häufigkeit wenigstens (und der Rest eines Syntagmas von es scheint so) wäre, hätte die Aussage die Aureole einer kategorischen Behauptung, was der Autor sorgsam scheut. Aber bei Andrić kommt es nicht nur zum „Beschränken", wenn er die gegenständliche Wirklichkeit erwähnt, das gleiche Verfahren wendet er auch einmal in seinem Nachlass, wo das Objekt das menschliche Wesen ist:
Immer wenn ich in der Gesellschaft einfacher Leute war, die im Leben eine bestimmte Arbeit verrichten, und die sie mit Liebe oder w enigstens [hervorgehoben von K.P.] mit Geduld verrichten, fühlte ich mich gut und es scheint mir [hervorgehoben wieder von demselben], war ich auch selbst besser. (Sveske, Sarajevo 1982,
- Also: Ohne das schon typisierte wenigstens in vielen „Beschränkungen“ und ohne das es scbeint mir – würde die Elokution (und Generalisienmg in ihr) unaufhaltsam stark in Richtung verzierender Idealisierung ziehen (oder wenigstens: Absolutisierung), was der Autor, es wird offensichtlich so sein, auf keinen Fall wollte, dass man nicht denkt, er sei ein solipsistischer Narziss. Ein homologes Verfahren bei Vladimir Primorac:
Ich muss sagen – wenn es um Verbrechen geht – bin ich kein Anhänger einer Opportunität, ich bin ein harter Legalist, der ein wenig [hervorgehoben von K.P] zum Ausspruch neigt: Es geschehe Recht, und sollte die Welt zugrunde gehen (188)
Jetzt ist Gelegenheit, die Interpretation (das Interpretatiönchen) weiterzuführen: Ohne das harmlose Adverb etwas: Fiat institia (et) pereat mundus wäre das Absolut eines harten, und unbarmherzigen, ausnahmslosen Legalismus (sich selbst zum Zweck) bewahrt. Zur Gelegenheit passend: Primoracs Freunde bewahren und übermitteln die Erinnerung an „Vlado“ (sein Kosename), wie er als Richter, ein rigider Legalist, nach einem, obwohl rechtmäßigem Urteil, tage- (und nächte-)lang niedergeschlagen sein konnte, mit sich selbst bis ins Kleinste unzufrieden, da er dem Verurteilten (ob nun Delinquent oder Schwerverbrecher) nicht noch irgendeinen erleichternden Umstand gefunden hatte... Ein Richter, rigoros und gerecht, Legalist und Moralist, aber zugleich auch Mensch: immer und äußerst rücksichtsvoll!
- Ein zweites Beispiel, in dem Primorac zum Stilisierungsverfahren der „Beschränkung" greift, ist in der integral zitierten Kolumne „Hakenkreuz und Stern “ enthalten, aber dort ohne Kommentare:
In Kroatien wurde mit voller Heftigkeit der antifaschistische Kampf durch die NOB geführt und er schaffte es, den Kroaten ihr nationales Territorium in Istrien, Dalmatien und der Murinsel zurückzugewinnen. Er hat Kroatien innerhalb des wiederaufgebauten Jugoslawien einen gleichberechtigten verfassungsrechtlichen Status gesichert und das Recht zur Selbstbestimmung gebracht, ohne welches es viel schwerer und vielleicht auch nie die nationale Selbständigkeit erreicht hätte. (295)
Und wieder: Nur ein einziges „unschuldiges" Adverb vielleicht, eine ganze Aussage von kategorischer Abschätzung ohne w ielleihbt, gerade mit diesem vielleicht wird dies zurückgeführt auf eine hypothetische Vermutung, und das mit dem bekannten und hier kommentiertem (ausge)nutzten „Beschränkungs“-Verfahren, was (wieder) die (harte) Resolutheit amalgamiert mit der stilisierenden Relativierung. Dass dieses vielleicht auch virtuell für die nationale und staatliche Unabhängigkeit gewesen wäre, verneint („Gott sei Dank“) eine reale Tatsache, die bezeugt, dass der ausgezeichnete Experte“ des Volkerrechts (Ehre sei ihm und Dank!) am siebten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig (7.12.1991) im Namen der Arbitrage der Kommission der Friedenskonferenz über Jugoslawien seine Meinung äußerte, dass die SFR Jugoslawien im Desintegrationsprozess ist, und dass die Sezession ihrer Republiken ein legitimes Verfassungsrecht aus dem Jahre 1974 ist. (Diese Verfassung nennen viele Titos Testament zu Lebzeiten) – und dass aufgrund dieser Meinung am fünfzehnten Januar neunzehnhundertzweiundneunzig (15.1.1992) die Europäische Gemeinschaft in Straßburg die Unabhängigkeit Kroatiens (und Sloweniens) in den bestehenden Grenzen anerkannt hat.
- Und noch ein Beispiel aus dem gleichen Stilisierungsverfahren:
-
Wir sind ein Volk, das oft die abstrakten Normen oder Begriffe nicht versteht, und außerdem sehr oft nicht in guter Absicht nachdenkt und arbeitet, sondern in böser Absicht. (222)
Die Adverbien oft und sehr, es stimmt, sie „grenzen“ die Absolutisation der Aussage ein, aber die Aussage zeugt auch mit ihnen davon, dass der Autor (er ist ja Richter!) seinem Volk nicht schmeichelt, sondern ihm gegenüber kritisch und nicht nachlassend ist.
- Zvonimir Berković12, ein enger Freund der beiden Namensvetter, von Primorac („dem kroatischen Cato") und von Gotovac („dem kroatischen Cicero“) hat eine wunderbare (verbale) Kantilene komponiert (eben so: komponiert), er hatte den Wunsch – sagte er – „das ungeheure Bedürfnis, die beiden (d.h. Vladimir P. und Vlado G.) „mit demselben Text zu umfassen“:13
-
So ungefähr wie Brahms zwei Instrumente im zweiten Satz seines Doppelkonzerts für Violine und Violoncello (...) verbunden hat. Im ersten Satz gibt der Komponist den Virtuosen mehrere herrliche Gelegenheiten, dass sie alles zeigen, was sie können, dass sie mit technischer Geschicklichkeit wetteifern, sich mit ihren Ideen streiten, und die Inventionskraft messen, und dann kommt der zweite Satz, Andante, acht Minuten, die zu den schönsten gehören, die der Welt das europäische Musikgenie gegeben hat. Die Violine und das Violoncello spielen unisono die gleichen Noten, die gleichen Bewegungen mit den Bögen (...). Es genügt, dass ich die Augen schließe und – ich sehe sie. Sie sind im Aufbruch. Sie schreiten im gleichen Tempo, sie sprechen mit dem gleichen Schweigen, erdrückt von den gleichen Zweifeln. Ich frage nicht wohin sie gehen, denn ich ahne es. Sie sind unsere einzigen Zwei, für die ich annehme, dass sie Plutarch interessieren würden. Und die irgendwie in die „Vergleichenden Lebensläufe“ passen würden. („Globus“, 5.1.2001)
Vladimir Primorac war der festen Überzeugung von der unabdingbaren Nutzbarkeit der richtigen Institutionen; eine solche ist auch die (autonome) Universität mit ihren zahlreichen Asten. Wie Arzte, wenn sie sich bei den protokollarischen Promotionen mit dem hippokratischen Eid zu deontologischem Verhalten verpflichten, und die Absolventen anderer Akademischer Berufe/Vokationen verpflichten sich, dass sie den Wahrheiten ihrer Fächer ergeben dienen (=ministrieren) werden; es ist wünschenswert, dass das emblematisch Hippokratische nicht zum Hypokritischen wird!
Vladimir Primoracs Urteile sind ein wahres Bergwerk, aus dem auch in Zukunft eine Menge an unvergänglichen Lehren und Botschaften gezogen werden können, und mögen sie – mit Gottes Hilfe! – zu Pylonen unseres kollektiven Bewusstseins und Gewissens werden und bleiben.
Ich schließe, inkancaktisch, mit einem Paar von zwei formelhaften Aussagen in der Tradition der Beschwörung im Volksstokawischen: Wohl dem / O weh dem... Glücklich ist die Mitte, die einen blendend analytischen, diagnostizierenden und unbestechlichen Verstand (und ein flammendes Herz) wie Vladimirs /Primoracs hervorgebracht hat!
Weh der Mitte, die aus der Schatztruhe seiner Erfahrungen nichts in ihr kollektives Verhalten und ihre Sensibilität einbauen würde, wenigstens als zeitweiliges Korrektiv, wenn nicht auch als unvergängliche Orientierung!
1 Antonio (1918-1989), Violoncellist und Komponist, Gründer des Kammerensembles für Streichinstrumente Zagrebački solisti, bekannt durch seine Konzerte in der ganzen Welt.
2 Aus dem Interview mit Darko Hudelist, „Erasmus“, Nr. 7, 1994 (S. 23-32). Siehe auch andere offenbarende Teile des Interviews mit dem Autor im III. Teil des „Collages“!
3 Kroatischer Dichter (1865-1908), erfolglos blieb seine Suche nach einer Arbeitsstelle in Kroatien, so dass er als Lehrer in Bosnien tätig war und endlich die Stelle eines Redakteurs in der Literaturzeitschrift „Nada“ in Sarajevo bekam; titanischer Dichter des Schmerzes und Trotzes.
4 Predrag Matvejević; Ein Gespräch mit Krleža, Zagreb 1967; promoviert an der Pariser Sorbonne, Professor für französische Literatur an der Philosophischen Fakultät der Universität Zagreb, Jetzt Professor in Rom.
5 Autor des Distichons isc Petar Petrović Njegoš (1813-1851), montenegrinischer Dichter und Wladika; die weltliche und geistiche Macht übernahm er mit 17 Jahren (?!); das bekannteste Eposwerk – Gorski vijenac, aus dem der aufgeührte Distichon ist (es besteht auch eine deutsche Übersetzung des Epos).
6 Übersetzung von A. Schmaus: Petar Petrović Njegoš. Der Bergkranz. München 1963.
7 Aus dem Interview mit Heni Erceg, „Feral Tribune“, 31. März 1997.
8 Das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch, deutscher Philosoph (1885-1977), emigrierte vor dem Nazismus und kehrte 1948 zurück, emigrierte erneut 1957 vor dem Kommunismus aus der DDR.
9 Deutsches Original: Auf der Suche nach einer besseren Welt, München 1984.
10 Professor für Komparatistik an der Philosophischen Fakultät der Universität Belgrad, und schau: Gründer (1989) und noch immer Parteivorsitzender der SLS (=Serbisch-liberale Partei).
11 Monsieur Robert Badinter (1928), Professor für Rechtswissenschaften an der Sorbonne und der damalige Justizminister der Repubük Frankrekh.
12 Professor für Szenarien an der Theaterakademie der Universität Zagreb, Regisseur zweier Kultmusikfilme Rondo und Kontessa Dora, Kolumnist in, der Zagreber Wochenzeitung „Globus“; was die Freunde angeht, gestand der gleiche Professor öffentlich, dass ihm V. Primorac das Leben verändert hat (denn das ist die wahre Rolle einer richtigen Freundschaft).
13 P.S.: Ich selber musste dem analogen „unwiderstehlichen Bedürfnis“ nachgeben, das oben genannte Meisterwerk der Kantilenen-Episode in mein Textchen einzubauen. K.P.
Übersetzung der Beiträge in „In memoriam Vladimir Primorac “ (Most / Die Brücke, Zagreb 2001, 1-4, S. 296-321) aus dem Kroatischen: Geriena und Nada Karačić.

