Branko Tošović
Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. – Москва: Язык славяской культуры, 2006. – 560 с.
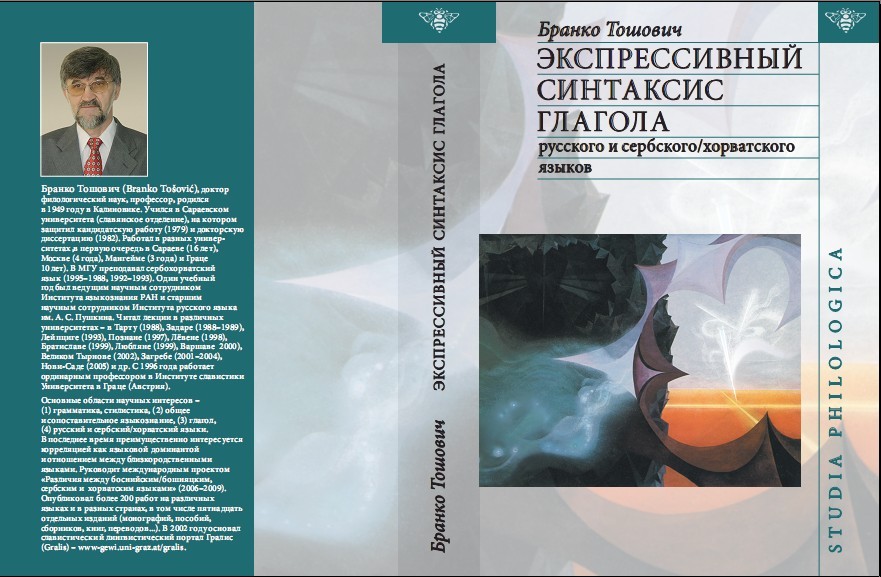
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltverzeichnis (Russisch)
- Einführung
- Expressivität
- Expressive Syntax
- Expressives Potential des Verbs
- Tempus
- Künstlerische Zeit
- Präsens
- Präteritum
- Futur
- Imperativ
- Konjunktiv
- Infinitiv
- Partizip
- Adverbialpartizip
- Verbale Interjektion
- Person
- Horizontale und vertikale Struktur des Verbs
- Substantielle Modifizierung des Verbs
- Schlusswort
- Abkürzungen
- Literatur
- Quellen
- Sachregister
- Namensregister
- Zusammenfassung (Englisch)
- Zusammenfassung (Deutsch)
- Zusammenfassung (Serbisch/Kroatisch)
- Inhaltsverzeichnis (Englisch)
- Inhaltsverzeichnis (Deutsch)
- Inhaltsverzeichnis (Serbisch/Kroatisch)
Expressive Syntax des Verbs des Russischen und Serbischen/Kroatischen
Branko Tošović
In diesem Buch werden drei Fragen untersucht: (1) Was ist
Expressivität, (2) welches expressives Potenzial besitzt die
Syntax, und (3) wie wird die Expressivität des Verbs auf der
syntaktischen Ebene gebildet und wie funktioniert sie.
In der Analyse der dritten Frage überschneiden sich der morphologische und syntaktische Aspekt, weswegen man die vorliegende Untersuchung auch als morphosyntaktisch bezeichnen kann. Am Anfang jedes thematischen Blockes werden die grundlegenden theoretischen Aspekte (die grammatikalischen und stilistischen) berührt. Da das zentrale Problem der Untersuchung einerseits ein interdisziplinäres und anderseits ein rein sprachwissenschaftliches Phänomen (die Expressivität und das Verb) ist, wird die Analyse auf einer breiteren Basis durchgeführt. Es wird deshalb im ersten Teil über die Expressivität generell und im zweiten Teil über das Verb als Wortart und über seine expressive Eigenschaften gesprochen.
Die Untersuchung wird auf Materialien des Russischen und des Serbischen/Kroatischen vorgenommen. Der Schrägstich im letzten Begriff (srpski/hrvatski – Serbisch/Kroatisch) bezeichnet, dass es sich um (a) soziolinguistisch zwei verschiedene Standardsprachen, (b) typologisch um eine Sprache oder um sehr nahe Sprachen handelt (da diese Frage keine linguistische Frage ist, wird sie in diesem Buch nicht berührt, und es wird auf sie nicht näher eingegangen). Somit ist unter der Nomination „srpski/hrvatski“ (Serbisch/Kroatisch“) „srpski i hrvatski“ (Serbisch und Kroatisch) zu verstehen, dennoch muss man manchesmal den Singular wie „u srpskom i hrvatskom jeziku“ verwenden.
Die Wahl des zweigliedrigen Namens ist auch dadurch bedingt, dass das untersuchte Material nicht ausschließlich nur serbisch oder nur kroatisch ist und dass in der Darstellung der analysierten Probleme sowohl die serbischen als auch die kroatischen Sprachwissenschaftler (sehr selten die bosniakischen/muslimischen) erwähnt werden.
Außerdem impliziert diese Nomination den dritten Erben der ehemaligen serbokroatischen Sprache – das Bosniakische, das in diesem Fall fehlt, weil (a) in unserem Buch keine Beispiele erwähnt wurden, die einzig für den sprachlichen Standard der Bosniaken/bosnischen Muslime typisch sind, (b) es eine weitere Bezeichnung für diese Sprache gibt – das Bosniakische (in Serbien und Kroatien bevorzugt), dessen Erwähnung die Metasprache dieses Buches noch zusätzlich erschweren könnte.
Der zweigliedrige Name ist auch auf das Bestreben zurückzuführen, (1) bei der Gegenüberstellung der Typen „die Expressivität der Gegenwartsform im Russischen, Bosnischen oder Bosniakischen, Serbischen und Kroatischen“ die Anhäufung von Namen zu vermeiden, (2) eine eventuelle Verwirrung (was womit verglichen wird) zu vermeiden und (3) sich ökonomisch auszudrücken.
Die grundlegende Aufgabe des kontrastiven Teiles der Analyse ist die Feststellung der wesentlichen Divergenzen zwischen den erwähnten Sprachen. Als Korpus werden die originalen Beispiele und deren Übersetzungen verwendet, wodurch ermöglicht wird, die Erscheinungen und die differentiellen Merkmale zwischen den Sprachen zu finden und zu vergleichen. Das Ungleichgewicht im expressiven Potential der russischen und serbischen/kroatischen Verben hat bewirkt, dass dieses nicht immer in gleichwertiger Weise betrachtet wurde. Dieses Ungleichgewicht wurde auch durch das verschiedene Niveau der Untersuchung (a) der Kategorie der Expressivität in der russischen und serbischen/kroatischen Sprachwissenschaft und (b) der Expressivität der Verben der untersuchten Sprachen bewirkt. Bei der Gegenüberstellung der Expressivität einerseits, der Emotionalität, des stilistischen Wertes, der Konnotativität, der Ausdruckskraft, der Anschaulichkeit (Bildlichkeit) und der ästhetischen Eigenschaften anderseits kamen wir zum Schluss, dass (1) keine von den oben genannten Kategorien mit der Expressivität in einer Relation der vollen Identität steht, (2) in ihrer Wechselwirkung die Beziehung der partiellen Kompatibilität entsteht, (3) sie in eine Beziehung der Überschneidung eintreten, (4) zwischen ihnen die Beziehung der Implizität scharf ausgeprägt ist und (5) es viel öfter zu einer Beziehung der Konjunktion als der Disjunktion kommt.
In diesem korrelativen Kreis gibt es drei Gruppen: In der ersten kommt die Expressivität als breiterer Begriff vor (in Bezug auf die Emotionalität, die Ausdruckskraft, die Anschaulichkeit und die Konnotativität), in der zweiten wird die Expressivität als engerer Begriff (in Bezug auf den stilistischen Wert) verwendet, und in der dritten kann die Expressivität sowohl als der breitere als auch der engere Begriff (in Bezug auf den ästhetischen Wert) auftreten.
Bezüglich der Art der Bildung unterscheiden wir die kodierte und dekodierte sowie hinsichtlich des Charakters der Realisierung die immanente und die kontextuelle Expressivität. Auf der allgemeinlinguistischen Ebene gibt es die Stratus-Expressivität und die differentiell-lektale Expressivität. Die Stratus-Expressivität stellt die Form der subjektiven, emotionalen oder ästhetischen Beziehungen dar, die mit den Mitteln einzelner sprachlicher Ebenen – graphische, phonetisch-phonologische, lexikalische, phraseologische, derivative, grammatikalische (morphologische und syntaktische) und textuelle realisiert wird. Die differentiell-lektale Expressivität kommt in einigen Lekten der introvertierten Differenzierung der Sprache vor und teilt sich in zwei Typen – den internen und den externen. Die interne Expressivität bildet die differentiell-lektale Diversifizierung der Sprache (stilistische, areale, temporale, soziale, mediative, teleologische, intellektuelle, psychologische, physiologische, individuelle...), wogegen die externe Expressivität bei der Infiltrierung der Elemente eines Typs der globalen Schichtung der Sprache (z. B. der sozialen) in einen anderen Typ (z. B. den funktional-stilistischen) entsteht.
Das expressive Potenzial der Grammatik besteht aus zwei Teilen: aus dem morphologischen und dem syntaktischen. Die morphologische Expressivität zeigt sich im Bereich (1) der Varietäten und der Synonyme der morphologischen Einheiten, (2) der morphologischen Paradigmen und (3) der Funktionalisierung der morphologischen Einheiten in den Stilen. Das expressive Potenzial der Syntax ist wesentlich umfangreicher als jenes der Morphologie. Es wird von syntaktischen Formen gebildet, besonders von stilistischen Figuren, emotionellen Konstruktionen (Ausrufungssätze), elliptischen Sätzen, redundanten syntaktischen Verbindungen, der Länge der Syntaxeme, der rhematischen Struktur der Sätze (Wortfolge, Inversion usw.). Es gibt sechs Hauptrichtungen in der Erforschung der expressiven Syntax. Die erste betrachtet die allgemeinen Probleme der syntaktischen Expressivität; in der zweiten steht im Zentrum der Aufmerksamkeit die Expressivität der syntaktischen Einheiten; die dritte hat die syntaktischen Figuren zum Gegenstand; die vierte konzentriert sich auf die Expressivität der synonymischen Konstruktionen und die fünfte analysiert die funktional-stilistischen Aspekte der Expressivität. In diesem Buch wird verstärktes Gewicht auf die sechste Richtung gelegt – die Untersuchung der syntaktischen Expressivität der Wortarten.
Der zentrale Teil der Analyse behandelt das expressive Potenzial des Verbs. Die Kategorie des Tempus bringt die zeitliche Lokalisierung dreier Makrodenotate zum Ausdruck, wobei es um drei nichtsubstantielle Eigenschaften geht: die Handlung, den Zustands und die Beziehung. Diese Makrodenotate fassen wir in einer Kategorie zusammen – dem denonativen Dyrestat (dy – die Dynamik, re – die Relation, stat – die Statik). Im Feld der Temporalität geschehen jene Prozesse, die zur Bildung verschiedener Arten der Expressivität führen. In einem von ihnen werden Verbalformen in das Feld anderer Verbalformen transponiert, wobei ein bestimmter Effekt ensteht. Hier scheint das Prinzip der Solidatität zu wirken, d. h. da sie ein begrenztes morphogisches Potenzial besitzen, helfen die Verbalformen einander.
Die Fähigkeit der Präsensformen zur Bezeichnung nicht nur eines Momentes der Rede, sondern auch eines breiteren Zeitabschnittes schafft die geeigneten Voraussetzungen für ihre breitere ekspressive Verwendung. Eine der markantesten Transpositionen ist der Gebrauch des Präsens für den Ausdruck von vorangegangenen Handlungen in Form des historischen Präsens. Sowohl im Russischen als auch im Serbischen/Kroatischen werden die Präsensformen in der Funktion des Futurums verwendet. Die russische Vergangenheitsform des vollendeten Aspektes benutzt man für den Ausdruck künftiger Handlungen als bereits eingetretene (wie мы погибли), und sie kann auch die Funktion des einfachen Futurums (получил = получу) übernehmen.
Einen umgangsprachlichen Charakter hat jene Konstruktion, in der eine ironische Konstatierung einer Handlung die durch die unvollendete Vergangenheitsform bezeichnet wird, die faktische Verneinung dieser Handlung in der Gegenwart ausdrückt (Да ну, боялся я её.). Besondere Expressivität haben die Vergangenheitsformen von präfixlosen Verben mit den Suffixe -а-, -ва-, -ыва/-ива- wie едал, знавал, видывал für die Bezeichnung der Wiederholung und des Andauerns der Handlung in der Vergangenheit. Die Formen mit -ану- von den Verben des vollendeten Aspektes (гульнул) bezeichnen eine einmalige, augenblickliche, intensive und unerwartete (manchmal ironische) Handlung.
Die Transposition im Feld der Vergangenheit des Serbischen/Kroatischen ist deutlich umfangreicher als die des Russischen, weil die vorangehende Handlung mit Hilfe von fünf Formen ausgedrückt werden kann: dem Perfekt, dem kurzen Perfekt, dem Aorist, dem Imperfekt und dem Plusquamperfekt. Das Perfekt kann durch den Aorist (skočio sam – skočih), das Imperfekt (držao sam – držah) und das Plusquamperfekt (čitao sam – bio sam čitao) ersetzt werden. Anderseits wird das Perfekt statt des Präsens und des Futurums verwendet. Das Perfekt kann auch die Funktion des Imperativs übernehmen, z. B. Hajde, prošetala! (= prošetaj). Das kurze Perfekt hat zwei stilistische Grundmerkmale: Es bezeichnet einerseits die Statik und potenziert anderseits die Handlung oder den Zustand. Der Aorist bezeichnet im Wesentlichen eine abgegrenzte Handlung in der Vergangenheit, die der Sprecher konstatiert oder erlebt hat, und wird zum Zweck der Potenzierung der Dynamik des Textes und der Schaffung von Lebhaftigkeit des Erzählens benützt. In letzter Zeit bekommt der Aorist (weniger das Imperfekt) ein neues Leben durch Internet-Foren, Chats, SMS-Mitteilungen und E-Mails. Die Verwendung des Imperfekts ist sehr begrenzt (faktisch befindet sich es in der Phase des Verschwindens). Das Plusquamperfekt kann man als Ersatz des Perfekts verwenden (pjevao sam – bijah pjevao), doch kommt auch dieses allmählich aus dem Gebrauch.
Auf das expressive Potenzial des Futurums in den betrachteten Sprachen, vor allem auf seine figurative Verwendung (zur Bezeichnung von Handlungen in der Gegenwart und Zukunft) haben die folgenden Faktoren entscheidenden Einfluss: 1. Die Zukunft ist derart eng mit der Gegenwart verbunden, dass das Präsens sehr oft in der Bedeutung des Futurums und umgekehrt verwendet wird, und andererseits sich der Unterschied zwischen ihnen sehr oft verliert, 2. die Zukunft stellt eine potenzielle Realisierung einer bestimmten Handlung, eines Prozesses oder Zustands dar, weshalb sich das Futur und der Imperativ miteinander verflechten und gegenseitig ersetzen.
Das Futurum wird statt des Perfekts (sog. historisches Futurum, das Futurum in der Gegenwart) verwendet. Das russische Futurum wird manchmal vom Partikel как für die Bezeichnung des unerwarteten Anfangs einer einmaligen Handlung mit intensiver Dauer begleitet (Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет).
Eine besondere Expressivität besitzt der russische Imperativ, der in der Bedeutung der Vergangenheit verwendet wird (А Данило и скажи ему...). Im Serbischen/Kroatischen ist dieser Gebrauch des Imperativs nicht (oder fast nicht) typisch. In dieser Sprache wird der Imperativ für die Bezeichnung einer vergangenen Handlung, die gewohnheitsmäßig vollzogen wird oder einer Handlung mit einfacher Dauer verwendet (Te malo popij, malo popričaj, taman da naiđem na tebe). Diese Form wird als erzählerischer (deskriptiver) Imperativ bezeichnet. Trotz ihrer Ähnlichkeit stimmen der russische dramatische Imperativ und der serbische erzählerische Imperativ nicht überein. Die russische Form wird vorwiegend für die Bezeichnung der vollendeten Handlung gebraucht, ohne deren Dauern zu konkretisieren, wogegen die serbische/kroatische Form wesentlich seltener von Verben des vollendeten Aspektes gebildet wird.
Der serbische/kroatische Konjunktiv (potencijal/kondicional) unterscheidet sich vom russischen vor allem dadurch, dass er für den Ausdruck einer Handlung verwendet werden kann, die in der Vergangenheit mehrmals wiederholt wurde oder in einer bestimmten Kontinuität geschah (ein derartiger Konjunktiv besitzt besondere Expressivität), was in der serbischen/kroatischen Terminologie mit einen eigenen Terminus bezeichnet wird – perfekatski ili pripovjedački potencijal/kondicional (der präteritale oder erzählerische Konjunktiv).
Der russische Infinitiv kann in der Bedeutung des Imperativs vorkommen und bezeichnet dann einen kategorischen Befehl, ein Verbot (Молчать!). Im Serbischen/Kroatischen ist diese Verwendung nicht typisch; als Hauptmittel dienen Substantive und verschiedene Konstruktionen (Tišina! Ni riječi! Da niko nije pisnuo!) usw. Im Russischen gibt es den sog. unabhängigen Infinitiv (Infinitiv in der Funktion des Subjekts oder Prädikats eines zweigliedrigen Satzes). Ein Beispiel der Verwendung des Infinitivs im Serbischen/Kroatischen zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich, weil es, soweit uns bekannt ist, in anderen slawischen Sprachen (das Slowenische ausgenommen) fehlt – der präpositionale Infinitiv (der Gebrauch zweier nicht kompatibler Formen in einer Konstruktion – der Präposition za und des Infinitivs wie z. B. za ponijeti). Die Tatsache, dass diese Konstruktion (1) ein Barbarismus, (2) fremd für das grammatikalische System ist und (3) alle normativen Lehrbücher gegen sie kämpfen, regt zu seiner Verwendung als stilistisches Mittel an.
Das expressive Potenzial der Partizipien ist mit ihrem Bedeutungsumfang, mit der Möglichkeit ihre positionellen Variierung, der Synonymisierung und der Bezeichnung der Erhabenheit und der Feierlichkeit verbunden. Ihre typische lautliche Ausdruckskraft, ihre Tonalität kann verschiedene Assoziationen evozieren. Hier hat das Russische einen Vorteil, weil es diesbezüglich vier Formen hat, und das Serbische/Kroatische nur zwei (besser gesagt – eine).
Unter den Formen der expressiven Verwendung der russischen Adverbialpartizipien kann ihre Verwendung zur Nachahmung der volkssprachlich-poetischen oder niedrigen, umgangsprachlichen Nuancierung der Sprache hervorgehoben werden. Eine besondere Expressivität besitzen die verbalen Interjektionen ohne Suffix (прыг, шлеп,– bub, tres), die in der Funktion des verbalen Prädikats und für die Bezeichnung von augenblicklichen, unerwarteten Handlungen in der Vergangenheit und zur Bezeichnung von deren Schnelligkeit und Intensität verwendet werden.
Wegen der großen transpositionellen Möglichkeiten wird die Kategorie der Person als eine der wichtigsten verbalen Kategorien angesehen. Das Merkmal der Possesivität wird auf zwei Arten ausgedrückt: denotativ und konnotativ. Die letztere bezeichnet den Verstoß gegen die Symmetrie: 1. Person = der Sprecher, 2. Person = die anwesende Person, 3. Person = die abwesende Person. Meistens wird die 1. Person Singular ersetzt, seltener die 1. und 3. Person Plural.
Wenn man die übliche Anordnung der Verben im Satz oder im Vers bewusst verletzt, bzw. wenn sie an einer Stelle verwendet werden, wo sie gewöhnlich nicht stehen, oder wenn sie in einen ungewohnten Kontext ohne Änderung des Inhalts gesetzt werden, entsteht eine verbale Figur. Für die Bildung solcher expressiven Konstruktionen werden verschiedene Verfahren verwendet: die Erweiterung, die Wiederholung, das Auslassen, die Positionsveränderung, unnatürlich Anordnung, die Ersetzung.
Eine der Formen der vertikalen expressiven Organisierung ist der Reim. Wegen der Besonderheit der lexikalischen und derivativen Strukturen auf dieser Ebene haben die einzelnen Wortarten ein unterschiedliches Potenzial. Einen Reim, dessen konstitutives Element ein Verbum ist, nennen wir verbalen Reim. Die semantische Vielfältigkeit, die breite Verbindbarkeit, der Reichtum der morphologischen Formen und das große expressive Potenzial prädestinieren das Verb zu einem wichtigen Mittel für die Bildung verschiedener Reimarten. Als Beweis ist die Tatsache anzusehen, dass alle verbalen Kategorien (das Tempus, der Aspekt, die Person, das Genus) im Reim vorkommen können.
Eine Form der sprachlichen Dynamik ist die Veränderung der formalen Struktur infolge verschiedener Transformationen, deren Resultat wir als Metaplasma bezeichnen. Je nachdem welches Verfahren verwendet wird, unterscheiden wir prostriktive und restriktive Metaplasmen. Das Verb wird folgenden Arten der Verkürzung unterzogen: a) der phonologischen, b) der morphologischen, c) der syntaktischen und d) der textuellen. Das erste Verfahren führt zur Entstehung eines Phonoplasmas, das zweite zieht ein Morphoplasma, das dritte ein Syntaktoplasma und das vierte ein Textoplasmas nach sich. Die Syntaktoplasmen und Textoplasmen stellen Formen von Zeroplasmen dar, da es sich um Nullformen auf der Ebene des Satzes handelt. Das Verfahren, das zur Entstehung eines Zeroplasmas führt, nennen wir Deverbalisierung.

